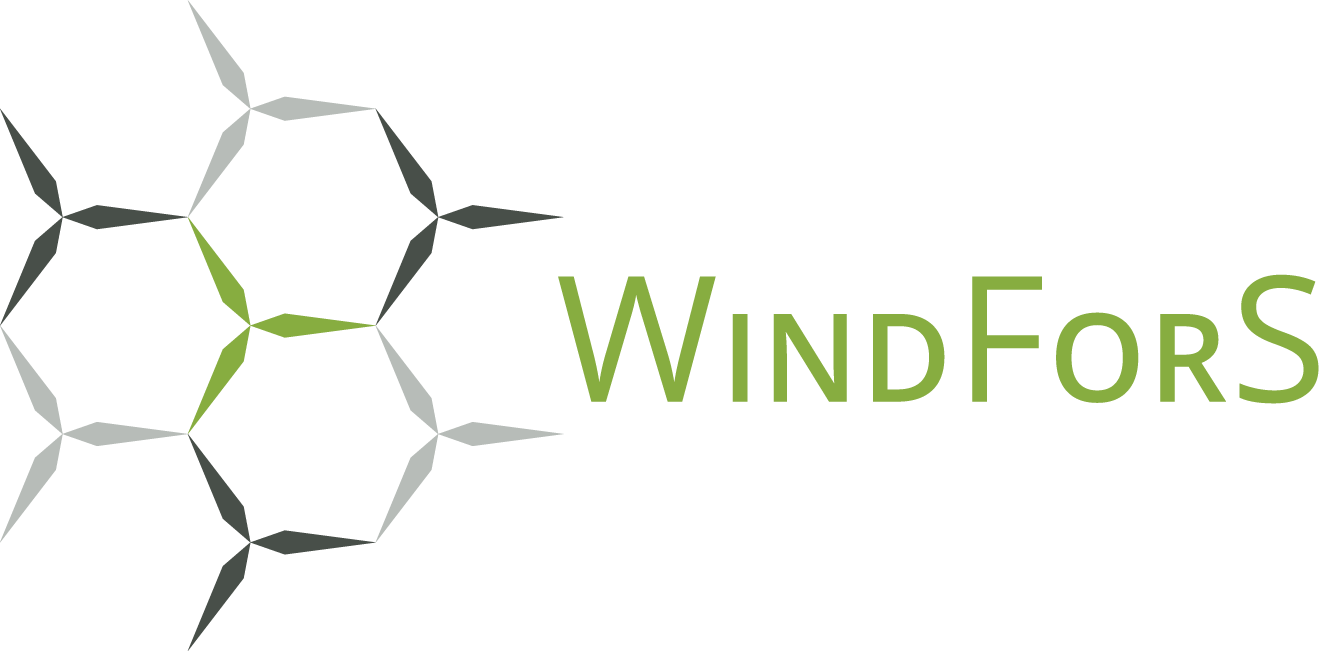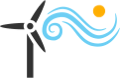bwHPC
High Performance Computing, Data Intensive Computing and Large Scale Scientific Data Management in Baden-Württemberg
bwHPC-S5 (sowie der Vorgänger bwHPC-C5 im Zeitraum 2013 - 2018) bilden die Brücke zwischen den Nutzern wissenschaftlicher Rechner an den Universitäten und HAWs und den HPC-Systemen in Baden-Württemberg.
Das Projekt ermöglicht die Nutzung der zur Verfügung gestellten HPC-Ressourcen für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen im Rahmen von CAE (i.e. numerische Strukturmechanik oder numerische Strömungsmechanik).
Das Projekt findet in Kooperation mit der Fakultät Informationstechnik statt. Projektseite bei IT.
Weitere Informationen sind auf der Projektseite zu finden: bwHPC-S5
Projektleiter
Prof. Dr.-Ing. Rainer Keller (IT)
Prof. Dr.-Ing. Rainer Stauch (MB)
Mitarbeiter
Michael Vögtle, M.Sc.
Dimension lab3
Simulation, Virtual- und Augmented Reality im MINT-Unterricht
Ziel des Verbundvorhabens „Dimension Lab 3“ ist es, vorhandene Berechnungs- und Simulationsmethoden für Bereiche, in denen die Anwendenden ein hohes plastisches, räumliches Vorstellungsvermögen sowie das richtige Einordnen von Dimensionen benötigen, durch innovative Visualisierungsmethoden besser darstellbar zu machen. Diese Bereiche betreffen insbesondere hochkomplexe, mehrdimen-sionale Problemstellungen aus z. B. der Aero- und Gasdynamik, Thermo-dynamik, Statik, u. ä.
Eine Interaktion mit den Anwendungsfällen soll durch Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality (VR) ermöglicht werden, wobei geeignete Methoden für ein intuitives Handling zu entwickeln sind. Diese Methoden kommen exemplarisch direkt verschiedenen Forschungsvorhaben in der Windenergieforschung zugute und werden dort prototypisch erprobt. Im Gegenzug liefern die Berechnungsergeb-nisse aus den laufenden Forschungsvorhaben wichtigen Input und damit die Basis für das Dimension Lab 3. Zudem werden digitale Prozesse im Bereich Building Information Technology entwickelt, da auch gebäude-technische Anwendungen betrachtet werden sollen.
Da es sich bei DimensionLab3 um ein Lehrprojekt handelt, geht es zunächst darum, Schülerinnen und Schüler für MINT-Fächer zu motivieren und den Weg zwischen Universität und Schule zu überbrücken. Die Visualisierung komplexer Themen kann eine Quelle der Immersion sein und hat somit die Fähigkeit, Motivation und Neugier bei den Studierenden zu wecken. Wir besuchen verschiedene Schulen mit vielfältigen Angeboten, um Schülern die Möglichkeiten der Digitalisierung und Simulation in den Natur- und Ingenieurwissenschaften näher zu bringen.
Das Projekt wurde zwar als Lehrprojekt beantragt, hat aber im Kern einen starken Forschungscharakter. Dies zeigt sich z. B. auch durch die Beteiligung des HLRS der Universität Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie hier.
Kooperationspartner/Projektpartner
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar)
Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS)
Förderung öffentlich
Stiftung Innovation in der Hochschullehre
Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr.-Ing. Hermann Knaus
Mitarbeiter
Yusra Tehreem, M.Sc.
Skare-Me
Skalenreduzierte Modellierung der Oxidation von Metallen für eine klimaneutrale Energieversorgung
Eine sichere, klimaneutrale Energieversorgung zählt aktuell zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Insbesondere chemische Energieträger ermöglichen hierbei die zeitlich und räumlich getrennte Ein- und Ausspeicherung von Energie im industriellen Maßstab. Metalle, deren gespeicherte chemische Energie über Oxidation (Verbrennung) in z.B. umgerüsteten Kohlekraftwerken genutzt werden kann, erfahren hier ein wachsendes Interesse. Für eine schnelle Implementierung der Technologie in bestehende Prozesse, ist eine simulationsgestützte Bewertung der Verfahren notwendig. Skalenreduzierte Ansätze wie die Reaktornetzwerkmodellierung können relevante Kennfelder (z.B. Umsatz, Schadstoffe) für die Auslegung bereitstellen. Dabei benötigen sie nur einen deutlich reduzierten Rechenaufwand im Vergleich zu detaillierten Simulationen. Das Ziel des Vorhabens ist die Weiterentwicklung der Modellierung der Oxidation von Eisen für den großtechnischen Maßstab. Kernpunkte des Arbeitsprogramms sind der Oxidationsprozess des Eisenpulvers, dessen Polydispersität und die Abbildung partikulärer Schadstoffe. Die im Vorhaben entwickelte Methodik kann somit einen wichtigen Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft leisten.
Förderung
Carl Zeiss Stiftung (CZS Forschungsstart)
Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr.-Ing. Sandra Hartl